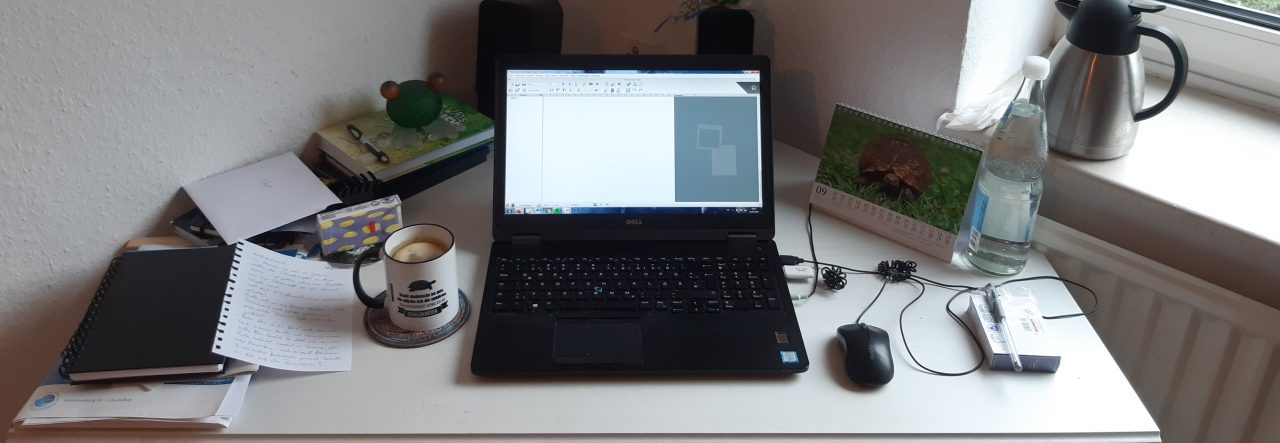Es ist zwanzig vor Sechs an einem Dienstagmorgen und das Krankenhaus liegt wie ausgestorben da. Ich gehe an der notdürftig errichteten Schranke vorbei, betrete das Gebäude, meine Umkleide ist fast leer. Zehn Minuten zum Umziehen, dann mache ich mich auf den Weg. Ich gehe über lange, leere Flure, in denen die Deckenbeleuchtung eigens für mich flackernd zum Leben erwacht, um nach mir wieder zu erlöschen. Geschlossene Bürotüren, die sich den ganzen Tag über nicht öffnen werden, ein dunkler Kiosk, ein gesperrter Andachtsraum. Wer kann, bleibt zuhause. Es ist beklemmend, fast so, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Die letzte Krankenschwester, die zu ihrem Dienst geht, duldsam und pflichtbewusst.
An den Fahrstühlen hängen grellgelbe Informationstafeln, maximal zwei Personen sind pro Aufzug gestattet. Seit Tagen dürfen keine Besucher mehr herkommen. Mütter bringen ihre Babys alleine zur Welt, ohne einen Vater, der ihre Hand hält. Eltern bangen um ihre Kinder, nur einer von beiden darf zu den kleinen Patienten. Alte und Kranke haben keine Gelegenheit mehr, sich von ihrer Familie zu verabschieden, sie sterben alleine oder mit maximal einer weiteren Person. Es ist nicht schön, aber so sind die neuen Richtlinien.
Das Virus hat uns fest im Griff.
Es wird nicht für immer sein.
Die Station, auf der ich arbeite, ist zur Hälfte geschlossen. Wir müssen Zimmer und Betten freihalten, um notfalls Infizierte aufnehmen zu können. Alle Eingriffe, die nicht lebensnotwendig sind, wurden längst abgesagt. Wer kann, geht nach Hause und bleibt dort. Überall hängen Schilder, weisen darauf hin, dass man mit Fieber und Erkältungssymptomen das Haus nicht unangemeldet betreten darf.
Meine Patienten sind einsam und verunsichert. Eine junge Frau hat Fieber, wir wissen noch nicht, warum, hat sie das Virus oder nur einen harmlosen Infekt? Sie hat Angst, wir sind hilflos, müssen auf das Testergebnis warten und hoffen.
Die Ärzte sehen müde und abgekämpft aus, genau wie wir Pflegekräfte, wie die Reinigungskräfte und alle anderen, die dem Virus zum Trotz jeden Tag herkommen. Überall Personalausfälle, Kollegen in Quarantäne, wir sind schon in guten Zeiten viel zu wenige. Stündlich kommen neue Verfahrensanweisungen, wir behalten kaum den Überblick. Urlaub wird gestrichen, das macht nichts, sagt eine ärztliche Kollegin, man darf ja ohnehin nicht mehr wegfahren, da kann man auch arbeiten gehen. Irgendwer muss ja.
Das Virus hat uns fest im Griff.
Es wird nicht für immer sein.
Unser Radio haben wir längst ausgeschaltet. Da wird zu viel Panik verbreitet, wir haben keine Kraft mehr, uns das anzuhören. Keine Kraft für neue Gerüchte, für wilde Vermutungen und wissenschaftlich nicht fundierte Aussagen. Es gibt schon genug Angst überall.
Wir mussten unsere Vorräte an Desinfektionsmitteln, Atemmasken und Schutzkitteln wegschließen, weil sonst alles geklaut wird. Die Leute fürchten sich, und statt einander zu helfen, schaden sie anderen ohne Rücksicht auf Verluste. Draußen sind die Supermärkte leergekauft. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Zeiten lebe, in denen man froh sein muss, genug Essen im Haus zu haben. Wie viel man doch als selbstverständlich hingenommen hat!
Das Ergebnis der Patientin mit Fieber kommt an, sie ist nicht infiziert. Wir sind erleichtert, ein kleiner Triumph. Schon wieder gibt es neue Anweisungen, die Eingangstüren der Station öffnen sich nur noch auf Knopfdruck statt wie sonst automatisch.
Mein Dienst endet, ich gehe durch leere Flure zurück zur Umkleide, ziehe mich um. Der Parkplatz vor dem Krankenhaus ist gespenstisch leer, wo man sonst vor lauter Autos kaum den Asphalt sehen kann. Ich bin zu Fuß hier. Leere Straßen auf dem Heimweg, wer kann, bleibt zuhause. Restaurants, Kinos, Schwimmbäder, alles musste schließen. Es gibt kein öffentliches Leben mehr, Kultur und Vergnügen sind bis auf weiteres abgesagt. Das Virus hat uns fest im Griff.
Es wird nicht für immer sein. Jede Pandemie hat ein Ende, auch diese hier. Wir müssen nur durchhalten. Wir müssen zueinander stehen, uns unterstützen und aufeinander Acht geben. Wir müssen nur lange genug weitermachen, und am Ende wird alles gut werden.
Vielleicht dauert es noch ein paar Wochen, vielleicht Monate. Doch irgendwann wird die Normalität zurückkehren, wir werden wieder nach draußen gehen und ein gewöhnliches Leben führen können. Alles wird gut, irgendwann.
Wir müssen nur durchhalten.

Ich erinnere mich noch gut an die Stimmung dieser Tage. An die Angst, die Hilflosigkeit, ans Alleinegelassenwerden. Vieles hat sich seitdem verändert. Vieles ist gleich geblieben.
Wenn ich den Text lese, den ich vor etwas über einem Jahr geschrieben habe – damals, als der erste Lockdown begann – kommt vor allem die Enttäuschung zurück. Darüber, dass die Leute aus einem Krankenhaus gestohlen haben. Aus einem Krankenhaus.
Damals war ich optimistischer, als ich es heute bin. Aber ich bleibe bei meiner Meinung: wir müssen durchhalten, und irgendwann wird es besser werden. Diesen Glauben lasse ich mir nicht nehmen.